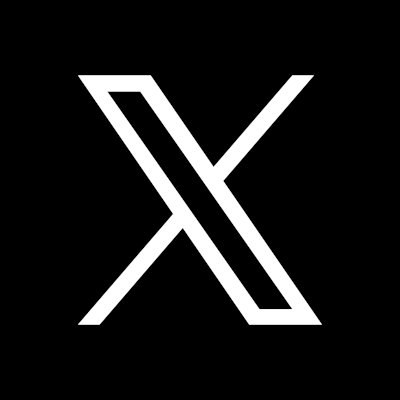- GU Home
- PR & Kommunikation
- Presse
- Pressemitteilungen 2009
- August 2009
- Den Ursachen des Tinnitus auf der Spur
Aug
30
2009
Manuela Nowotny erforscht, welche Schädigungen der Hörschnecke die belastenden Ohrgeräusche erzeugen
Den Ursachen des Tinnitus auf der Spur
FRANKFURT. Fast drei Millionen Menschen leiden in Deutschland an Tinnitus. Die Ohrgeräusche, für die es keine äußere Schallquelle gibt, äußern sich als Brummen, Zischen, Rauschen, Pfeifen, Klopfen oder Knacken. Für etwa 800.000 Betroffene ist dieses Leiden mit Schlafstörungen, Angstzuständen, Depressionen und Arbeitsunfähigkeit verbunden. Eine wirksame Therapie gibt es bislang nicht, weil die Ursachen für die Entstehung des Tinnitus und sein Fortbestehen durch einen Lerneffekt im Gehirn nicht verstanden sind. Hier setzt ein interdisziplinäres Forschungsprojekt von Neurobiologen der Goethe-Universität ein.
Zurzeit geht man davon aus, dass der Tinnitus mit einer Schädigung des Innenohrs beginnt. Diese kann durch einen Hörsturz, ein Knalltrauma, zu laute Musik, aber auch Medikamente ausgelöst werden. Allerdings ‚verselbständigt‘ sich das Phänomen, wie man von Patienten weiß, denen der Hörnerv auf eigenen Wunsch durchtrennt wurde. Da der Tinnitus dadurch nicht verschwand, nimmt man an, dass er durch einen Lerneffekt des Gehirns aufrecht erhalten wird. „Wir müssen also verstehen, wie der Tinnitus im Innenohr entsteht, andererseits aber auch die Gehirnregionen ausfindig machen, in denen er sich dauerhaft manifestiert“, erklärt Dr. Manuela Nowotny, die für ihr Forschungsprojekt kürzlich mit dem Adolf Messer-Stiftungspreis ausgezeichnet wurde.
Die Neurobiologin untersuchte bereits an Heuschrecken, wie Schallwellen von den Sinneszellen in elektrische Reize umgewandelt werden. Bei Heuschrecken liegt das Hörorgan auf den Vorderbeinen, wo es für Experimente leichter zugänglich ist als bei Säugern. Für die Untersuchungen zum Tinnitus wählte die Forscherin aber die Wüstenrennmaus, weil deren Hörbereich mit demjenigen des Menschen weitgehend übereinstimmt. Einen vorübergehenden Tinnitus kann man bei dem Tier medikamentös durch Salizylat hervorrufen. Dies ist ein Bestandteil des Schmerzmittels Acetylsalicylsäure. Doch woher weiß die Forscherin, dass der Tinnitus bei der Rennmaus eingesetzt hat? „Früher war dazu ein relativ langes Verhaltenstraining notwendig“, sagt sie, „beispielsweise wurde das Tier darauf trainiert, bei Geräuschsignalen an einer Trinkflasche zu lecken, und dann bestimmte man die Leckrate.“ Weniger Aufwand ist es, den Schreckreflex der Tiere zu nutzen. Das unwillkürliche Aufzucken bei einem lauten Geräusch lässt sich auf einer Messplattform in ein elektrisches Mess-Signal umwandeln, das Aufschluss über die Intensität der Schreckreaktion gibt. Man weiß, dass ein leises Signal, das kurz vor einem Knall kommt, die Schreckreaktion stark abschwächt. Denn dann merkt das Tier auf und erschrickt weniger heftig. Wüstenrennmäuse mit einem Tinnitus können solche leisen Hinweise nicht hören und erschrecken daher genauso stark wie zuvor. Dass sie für diese Art von Versuchen geeignet sind, konnten Nowotny und ihre Kollegen Priv. Doz. Bernhard Gaese (Goethe-Universität Frankfurt) und Prof. Peter Pilz von der Universität Tübingen in einer kürzlich publizierten Arbeit nachweisen. Um die Ursache des Tinnitus im Innenohr zu verstehen und dann gezielt Medikamente testen zu können, will Nowotny herausfinden, welche Bereiche der Hörschnecke jeweils geschädigt sind. Diese ist so aufgebaut, dass hohe Frequenzen an der Basis des Hörorgans wahrgenommen werden, die niedrigen dagegen an der Spitze. Bei einem Tinnitus, der durch laute Musik oder einen Knall hervorgerufen wurde, erwartet sie somit, eine Schädigung in dem Bereich der Schnecke zu finden, der mit der Frequenz des schädigenden Schalls übereinstimmt. „Ob diese Schädigung auch den resultierenden Tinnitus beeinflusst, ist für die medikamentöse Therapie von fundamentaler Bedeutung“, erläutert die Forscherin, „denkbar wäre auch, dass die Randbereiche der Schädigung die Quelle der Fehlfunktion sind“. Ergänzend dazu untersuchen die Neurobiologen Prof. Manfred Kössl und Priv. Doz. Bernhard Gaese, welche Hirnregionen bei Tinnitus aktiv sind und wie der ‚Lerneffekt‘ entsteht.
Die notwendigen Laborgeräte für ihre Arbeit konnte die Nachwuchswissenschaftlerin Dank des mit 25.000 Euro dotierten Adolf Messer-Preises anschaffen. Sie ist außerdem Stipendiatin der Main Campus Stiftung der Polytechnischen Gesellschaft, die unter anderem Habilitierende mit Kindern unterstützt. Das von den Stipendiaten gewünschte soziale Engagement leistet Manuela Nowotny schon länger als Schöffin am Frankfurter Landgericht. So hat sie abends noch Zeit für ihren zweijährigen Sohn.
Informationen Dr. Manuela Nowotny, Neurobiologie und Biosensorik, Bio-Campus Siesmayerstraße, Tel: (069)798–24744, nowotny@bio.uni-frankfurt.de.
Zurzeit geht man davon aus, dass der Tinnitus mit einer Schädigung des Innenohrs beginnt. Diese kann durch einen Hörsturz, ein Knalltrauma, zu laute Musik, aber auch Medikamente ausgelöst werden. Allerdings ‚verselbständigt‘ sich das Phänomen, wie man von Patienten weiß, denen der Hörnerv auf eigenen Wunsch durchtrennt wurde. Da der Tinnitus dadurch nicht verschwand, nimmt man an, dass er durch einen Lerneffekt des Gehirns aufrecht erhalten wird. „Wir müssen also verstehen, wie der Tinnitus im Innenohr entsteht, andererseits aber auch die Gehirnregionen ausfindig machen, in denen er sich dauerhaft manifestiert“, erklärt Dr. Manuela Nowotny, die für ihr Forschungsprojekt kürzlich mit dem Adolf Messer-Stiftungspreis ausgezeichnet wurde.
Die Neurobiologin untersuchte bereits an Heuschrecken, wie Schallwellen von den Sinneszellen in elektrische Reize umgewandelt werden. Bei Heuschrecken liegt das Hörorgan auf den Vorderbeinen, wo es für Experimente leichter zugänglich ist als bei Säugern. Für die Untersuchungen zum Tinnitus wählte die Forscherin aber die Wüstenrennmaus, weil deren Hörbereich mit demjenigen des Menschen weitgehend übereinstimmt. Einen vorübergehenden Tinnitus kann man bei dem Tier medikamentös durch Salizylat hervorrufen. Dies ist ein Bestandteil des Schmerzmittels Acetylsalicylsäure. Doch woher weiß die Forscherin, dass der Tinnitus bei der Rennmaus eingesetzt hat? „Früher war dazu ein relativ langes Verhaltenstraining notwendig“, sagt sie, „beispielsweise wurde das Tier darauf trainiert, bei Geräuschsignalen an einer Trinkflasche zu lecken, und dann bestimmte man die Leckrate.“ Weniger Aufwand ist es, den Schreckreflex der Tiere zu nutzen. Das unwillkürliche Aufzucken bei einem lauten Geräusch lässt sich auf einer Messplattform in ein elektrisches Mess-Signal umwandeln, das Aufschluss über die Intensität der Schreckreaktion gibt. Man weiß, dass ein leises Signal, das kurz vor einem Knall kommt, die Schreckreaktion stark abschwächt. Denn dann merkt das Tier auf und erschrickt weniger heftig. Wüstenrennmäuse mit einem Tinnitus können solche leisen Hinweise nicht hören und erschrecken daher genauso stark wie zuvor. Dass sie für diese Art von Versuchen geeignet sind, konnten Nowotny und ihre Kollegen Priv. Doz. Bernhard Gaese (Goethe-Universität Frankfurt) und Prof. Peter Pilz von der Universität Tübingen in einer kürzlich publizierten Arbeit nachweisen. Um die Ursache des Tinnitus im Innenohr zu verstehen und dann gezielt Medikamente testen zu können, will Nowotny herausfinden, welche Bereiche der Hörschnecke jeweils geschädigt sind. Diese ist so aufgebaut, dass hohe Frequenzen an der Basis des Hörorgans wahrgenommen werden, die niedrigen dagegen an der Spitze. Bei einem Tinnitus, der durch laute Musik oder einen Knall hervorgerufen wurde, erwartet sie somit, eine Schädigung in dem Bereich der Schnecke zu finden, der mit der Frequenz des schädigenden Schalls übereinstimmt. „Ob diese Schädigung auch den resultierenden Tinnitus beeinflusst, ist für die medikamentöse Therapie von fundamentaler Bedeutung“, erläutert die Forscherin, „denkbar wäre auch, dass die Randbereiche der Schädigung die Quelle der Fehlfunktion sind“. Ergänzend dazu untersuchen die Neurobiologen Prof. Manfred Kössl und Priv. Doz. Bernhard Gaese, welche Hirnregionen bei Tinnitus aktiv sind und wie der ‚Lerneffekt‘ entsteht.
Die notwendigen Laborgeräte für ihre Arbeit konnte die Nachwuchswissenschaftlerin Dank des mit 25.000 Euro dotierten Adolf Messer-Preises anschaffen. Sie ist außerdem Stipendiatin der Main Campus Stiftung der Polytechnischen Gesellschaft, die unter anderem Habilitierende mit Kindern unterstützt. Das von den Stipendiaten gewünschte soziale Engagement leistet Manuela Nowotny schon länger als Schöffin am Frankfurter Landgericht. So hat sie abends noch Zeit für ihren zweijährigen Sohn.
Informationen Dr. Manuela Nowotny, Neurobiologie und Biosensorik, Bio-Campus Siesmayerstraße, Tel: (069)798–24744, nowotny@bio.uni-frankfurt.de.
- Aktuelles und Presse
- Pressemitteilungen
- Öffentliche Veranstaltungen
- Uni-Publikationen
- Aktuelles Jahrbuch
- UniReport
- Forschung Frankfurt
- Aktuelle Stellenangebote
- Frankfurter Kinder-Uni
- Internationales
- Outgoings
- Erasmus / LLP
- Goethe Welcome Centre (GWC)
- Refugees / Geflüchtete
- Erasmus +
- Sprachenzentrum oder Fremdsprachen
- Goethe Research Academy for Early Career Researchers
- Forschung
- Research Support
- Forschungsprojekte, Kooperationen, Infrastruktur
- Profilbereich Molecular & Translational Medicine
- Profilbereich Structure & Dynamics of Life
- Profilbereich Space, Time & Matter
- Profilbereich Sustainability & Biodiversity
- Profilbereich Orders & Transformations
- Profilbereich Universality & Diversity