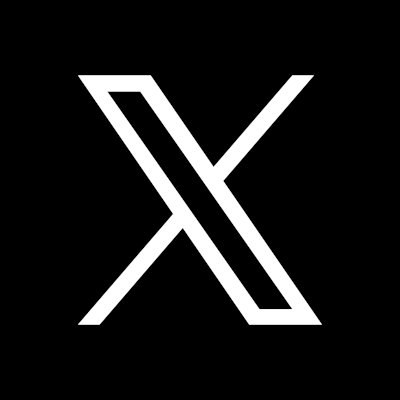- GU Home
- PR & Kommunikation
- Presse
- Pressemitteilungen 2006
- Dezember 2006
- Warum sollten Frauen nicht erste Wahl sein?
Dez
29
2006
Studie zum Generationswechsel in Familienunternehmen
Warum sollten Frauen nicht erste Wahl sein?
FRANKFURT. Wenn es darum geht, ob Töchter oder Söhne die Nachfolge in mittelständischen Unternehmen antreten, gibt es erhebliche Unterschiede: Frauen besetzen häufig Bereiche wie Personal oder Unternehmenspolitik und sind seltener in der Führung des operativen Geschäfts zu finden. Weshalb begrenzen Väter die Verantwortung ihrer Töchter? Liegt es an den Töchtern, die – anders als Söhne – kaum dazu neigen, die Macht an sich zu reißen? Oder liegt es an den Vätern, die an den Fähigkeiten ihrer Töchter zweifeln? Sicher ist, dass traditionelle Vorbehalte gegen Frauen an der Unternehmensspitze grundlos sind: Selbst in Branchen, die von Männern dominiert werden, setzen sie sich erfolgreich durch, wenn sie ihre Chance bekommen. Über die Ergebnisse ihrer im Auftrag des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend erstellten Studie berichten Rolf Haubl, Professor für Soziologie und psychoanalytische Sozialpsychologie, und die Diplom-Ökonomin Bettina Daser in der neuesten Ausgabe des Wissenschaftsmagazins „Forschung Frankfurt“.
Die Mehrzahl der Konflikte resultiert aus dem Fortbestehen patriarchaler Familienstrukturen. Widerstände beim Generationswechsel können so groß sein, dass das vorhandene Potenzial der Frauen zum Schaden des Unternehmens nicht genutzt wird. Gelangen Töchter in die Geschäftsleitung, dann häufig nur deshalb, weil „Not am Mann“ ist: Krankheit oder Tod des Vaters, fehlende Söhne oder Söhne, die sich verweigern. Ansonsten haben Töchter dann die besten Chancen, wenn die Position in der Geschäftsleitung in Konkurrenz mit Brüdern oder anderen männlichen Verwandten leistungsgerecht besetzt wird. Dazu bedarf es eines fairen Wettbewerbs. Wenn unter der Vorgabe einer chancengleichen und leistungsgerechten Geschwisterkonkurrenz letztlich doch das Geschlecht den Ausschlag gibt, kränkt das eine Tochter besonders schwer, denn auf ihr Geschlecht hat sie nun einmal keinen Einfluss. Es gibt Töchter, die auf solche Kränkungen sogar selbstschädigend reagieren: Sie wollen nicht glauben, dass es ihr Geschlecht ist, das sie scheitern lässt, weil das ihre ganze Person entwerten würde. Und so fangen sie an, nach Gründen zu suchen, die denen Recht geben, die sie benachteiligen.
Die Ergebnisse der Untersuchung beruhen auf einer aufwändigen interpretativen Auswertung von 53 mehrstündigen themenzentrierten Interviews mit Töchtern, die in mittelständischen Familienunternehmen erfolgreich die Geschäftsleitung übernommen haben oder an einer angestrebten Übernahme gescheitert sind. In den Interviews wurde deutlich, dass die Frauen, die ihren Anspruch auf Nachfolge nicht durchsetzen konnten, über eine ebenso gute berufliche Qualifikation wie die erfolgreichen Nachfolgerinnen verfügen. Dass sie nicht aufgrund mangelnder beruflicher Qualifikationen scheitern, zeigt sich unter anderem daran, dass sie außerhalb des Unternehmens ihrer Familie sehr wohl Karriere machen. Generell gewannen Haubl und Daser den Eindruck, dass es Frauen oft leichter fällt, ein eigenes Unternehmen zu gründen, als das ihrer Eltern zu übernehmen. „Scheitern sie an der Nachfolge, dann in der Regel an der unterschätzten oder sogar unbewussten emotionalen Dynamik innerfamiliärer Konflikte, die nicht beigelegt werden konnten“, konstatiert Bettina Daser.
Diese im Auftrag des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend durchgeführte Studie haben die beiden Wissenschaftler des Fachbereichs Gesellschaftswissenschaft in Kooperation mit dem Frankfurter Sigmund-Freud-Institut organisiert; sie wurde zusätzlich aus Mitteln des Präsidiums der Universität für Genderforschung unterstützt.
Prof. Dr. Dr. Rolf Haubl und seine Mitarbeiterin Bettina Daser haben nun vor, aus den Erkenntnissen der Studie gezielte Beratungskonzepte zu entwickeln. Dazu Haubl: „Die Ergebnisse können helfen, die Beratung von Familienunternehmen auch über eine konkrete Frauenförderung hinaus zu optimieren. Eine wissenschaftlich fundierte Beratung, die nicht nur die üblichen betriebswirtschaftlichen sowie steuer- und erbschaftsrechtliche Fragen behandelt, sondern auch die erforderliche Sensibilität für die Familiendynamik von Unternehmerfamilien aufbringt, kann maßgeblich dazu beitragen, den Generationswechsel zu sichern.“ Diese Aufgabe verlangt entsprechend geschulte Beraterinnen und Berater, von denen es bislang zu wenige gibt. Deshalb arbeitet das Sigmund-Freud-Institut jetzt an einem Schulungsprogramm, das die Kompetenz von Beraterinnen und Beratern verbessern und die Beratungsresistenz von mittelständischen Familienunternehmen verringern soll.
Nähere Information: Prof. Dr. Dr. Rolf Haubl, Bettina Daser, Fachbereich Gesellschaftswissenschaften, Telefon 069-798-22044, daser@soz.uni-frankfurt.de (erreichbar ab 9. Januar 2007).
Die Mehrzahl der Konflikte resultiert aus dem Fortbestehen patriarchaler Familienstrukturen. Widerstände beim Generationswechsel können so groß sein, dass das vorhandene Potenzial der Frauen zum Schaden des Unternehmens nicht genutzt wird. Gelangen Töchter in die Geschäftsleitung, dann häufig nur deshalb, weil „Not am Mann“ ist: Krankheit oder Tod des Vaters, fehlende Söhne oder Söhne, die sich verweigern. Ansonsten haben Töchter dann die besten Chancen, wenn die Position in der Geschäftsleitung in Konkurrenz mit Brüdern oder anderen männlichen Verwandten leistungsgerecht besetzt wird. Dazu bedarf es eines fairen Wettbewerbs. Wenn unter der Vorgabe einer chancengleichen und leistungsgerechten Geschwisterkonkurrenz letztlich doch das Geschlecht den Ausschlag gibt, kränkt das eine Tochter besonders schwer, denn auf ihr Geschlecht hat sie nun einmal keinen Einfluss. Es gibt Töchter, die auf solche Kränkungen sogar selbstschädigend reagieren: Sie wollen nicht glauben, dass es ihr Geschlecht ist, das sie scheitern lässt, weil das ihre ganze Person entwerten würde. Und so fangen sie an, nach Gründen zu suchen, die denen Recht geben, die sie benachteiligen.
Die Ergebnisse der Untersuchung beruhen auf einer aufwändigen interpretativen Auswertung von 53 mehrstündigen themenzentrierten Interviews mit Töchtern, die in mittelständischen Familienunternehmen erfolgreich die Geschäftsleitung übernommen haben oder an einer angestrebten Übernahme gescheitert sind. In den Interviews wurde deutlich, dass die Frauen, die ihren Anspruch auf Nachfolge nicht durchsetzen konnten, über eine ebenso gute berufliche Qualifikation wie die erfolgreichen Nachfolgerinnen verfügen. Dass sie nicht aufgrund mangelnder beruflicher Qualifikationen scheitern, zeigt sich unter anderem daran, dass sie außerhalb des Unternehmens ihrer Familie sehr wohl Karriere machen. Generell gewannen Haubl und Daser den Eindruck, dass es Frauen oft leichter fällt, ein eigenes Unternehmen zu gründen, als das ihrer Eltern zu übernehmen. „Scheitern sie an der Nachfolge, dann in der Regel an der unterschätzten oder sogar unbewussten emotionalen Dynamik innerfamiliärer Konflikte, die nicht beigelegt werden konnten“, konstatiert Bettina Daser.
Diese im Auftrag des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend durchgeführte Studie haben die beiden Wissenschaftler des Fachbereichs Gesellschaftswissenschaft in Kooperation mit dem Frankfurter Sigmund-Freud-Institut organisiert; sie wurde zusätzlich aus Mitteln des Präsidiums der Universität für Genderforschung unterstützt.
Prof. Dr. Dr. Rolf Haubl und seine Mitarbeiterin Bettina Daser haben nun vor, aus den Erkenntnissen der Studie gezielte Beratungskonzepte zu entwickeln. Dazu Haubl: „Die Ergebnisse können helfen, die Beratung von Familienunternehmen auch über eine konkrete Frauenförderung hinaus zu optimieren. Eine wissenschaftlich fundierte Beratung, die nicht nur die üblichen betriebswirtschaftlichen sowie steuer- und erbschaftsrechtliche Fragen behandelt, sondern auch die erforderliche Sensibilität für die Familiendynamik von Unternehmerfamilien aufbringt, kann maßgeblich dazu beitragen, den Generationswechsel zu sichern.“ Diese Aufgabe verlangt entsprechend geschulte Beraterinnen und Berater, von denen es bislang zu wenige gibt. Deshalb arbeitet das Sigmund-Freud-Institut jetzt an einem Schulungsprogramm, das die Kompetenz von Beraterinnen und Beratern verbessern und die Beratungsresistenz von mittelständischen Familienunternehmen verringern soll.
Nähere Information: Prof. Dr. Dr. Rolf Haubl, Bettina Daser, Fachbereich Gesellschaftswissenschaften, Telefon 069-798-22044, daser@soz.uni-frankfurt.de (erreichbar ab 9. Januar 2007).
- Aktuelles und Presse
- Pressemitteilungen
- Öffentliche Veranstaltungen
- Uni-Publikationen
- Aktuelles Jahrbuch
- UniReport
- Forschung Frankfurt
- Aktuelle Stellenangebote
- Frankfurter Kinder-Uni
- Internationales
- Outgoings
- Erasmus / LLP
- Goethe Welcome Centre (GWC)
- Refugees / Geflüchtete
- Erasmus +
- Sprachenzentrum oder Fremdsprachen
- Goethe Research Academy for Early Career Researchers
- Forschung
- Research Support
- Forschungsprojekte, Kooperationen, Infrastruktur
- Profilbereich Molecular & Translational Medicine
- Profilbereich Structure & Dynamics of Life
- Profilbereich Space, Time & Matter
- Profilbereich Sustainability & Biodiversity
- Profilbereich Orders & Transformations
- Profilbereich Universality & Diversity